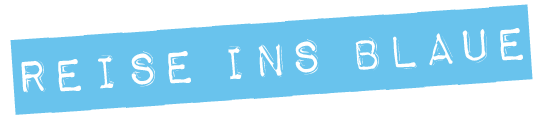Lissabon boomt, was die Besucherzahlen betrifft, bestätigen uns die Einheimischen. Das läge an den günstigen Preisen und der geringen Terrorgefahr. Trotzdem hat die Stadt seit den 80er Jahren fast die Hälfte ihrer Einwohner verloren, derzeit sind es um die 500.000. Das wiederum liegt an der maroden Bausubstanz (was allerdings bemerkbar behoben wird, alle paar Meter gibt es Baustellen, Kräne, Gerüste) und den hohen Mieten.
Es gibt fast so viel zu besichtigen wie in Rom, was wir aber – wie immer – nicht anstreben, weil es zum einen das meiste in leicht veränderter Form auch woanders in der Stadt und genau so gut zu entdecken gibt und wir zum anderen lieber finden als suchen, – das bringt Ruhe in die Reise, weil es nie etwas abzuhaken gibt.
Da wir schon ein paar mal gehört haben, Lissabon wäre zum Leben eine – womöglich die – Alternative zu Berlin, fließt hier auch der ein oder andere subjektive Vergleich mit ein.
Unsere erste Unterkunft ist unverhofft so zentral gelegen, dass man praktisch jeden interessanten Ort, egal in welcher Richtung gelegen, in einer halben Stunde erreichen kann. Allerdings muss man – da die Stadt (ebenso wie Rom) auf sieben Hügeln liegt – immer irgendwo hinauf und wieder hinunter. Hat dafür unverhofft immer wieder grandiose Ausblicke über die Stadt. (Spoiler: Das zweite Bild hier rechts ist der Ausblick von der Terrasse unserer zweiten Wohnung.)
In Berlin ist alles flach, aber elend weit voneinander entfernt. Hier gibt es sehr viele alte Häuser mit Kacheln verziert, aber wenig Bäume, in Berlin kaum Kacheln, dafür jede Menge Grünzeug. Der ganze Innenstadtbereich hat wunderbare Gebäude, von verwinkelt mittelalterlich, nordafrikanisch kasbah-ähnlich, südländisch mediterran, spelunkig abgerockt bis hin zu großzügigen Flaniermeilen in Art Deco. Berlin, – na ja. Aber bei der Street-Art gibt es durchwegs Parallelen.
Weil die Eindrücke so mannigfaltig und intensiv sind, soll/muss eine Auswahl von Favourits ausreichen:
Einen wunderbaren Platz zum Sonnenuntergang gibt es kurz unter dem Pharmazie- und Hygiene-Museum im Stadtteil Bairro Alto, den Miradouro de Santa Catarina. Hier ein schöner Beitrag aus einem anderen Blog zu der Statue auf dem Platz.
Dort trifft Mann/Frau/Alt/Jung sich ab dem späten Nachmittag zum Quatschen und einen Zwitschern, und es wird (gut riechbar) jede Menge Gras geraucht, das einem praktischerweise auf dem Hinweg im Sekundentakt angeboten wird. Die Stimmung ist überaus aufgeräumt, manchmal gibt es Livemusik – man kann hier sehr gut eine ganze Weile verbringen und dem Himmel beim Dunklerwerden zuschauen. Was wir den ein oder anderen Abend tun.
Im schon erwähnten Museum gibt es ein ambitioniertes Restaurant im Apothekendekor. Das Essen ist sehr gut und die kalte Suppe mit getrockneten Thunfischstreifen superb (bestes Gericht auf der Reise).
Im Bairro Alto herrscht ein bisschen Kreuzberg-Feeling, hip und abgerockt mit vielen Kneipen, aber auch Touristenfallen. In die am subtilsten gestaltete Falle tappen wir auf der Suche nach einem (möglichst authentischen nicht touristischen) Fado-Abend sehenden Auges hinein. Fado ist eine der Attraktionen der Stadt. Vom lateinischen Fatum = Schicksal abgeleitet, bezeichnet man damit eine Musik, die in den Armenvierteln von Lissabon im 19. Jh. entstand und die heute in Lissabon wie die Lederhosen in München als vermeintlich authentisch an den Tourist gebracht wird. Die Besetzung besteht in der Regel aus Gitarre, Cister und einer Sängerin, seltener einem Sänger. Man zahlt keinen Eintritt, dafür ist das Essen doppelt so teuer, denn es wird traditionell in Restaurants und Kneipen während des Betriebs musiziert. In den Stücken geht es immer mindestens um Leben und Tod und die Atmosphäre ist dementsprechend ernsthaft.
Wir sitzen direkt zwischen den Musikern und einer Handvoll junger Asiaten, die alle Brillen und Polohemden tragen und in ihre Handys vertieft sind. Das Rätsel, wie die hier hinein geraten sind, ist momentan fast interessanter als die Musik, die immer noch nicht angefangen hat. Daneben gibt es noch Engländer, Franzosen, Holländer und Deutsche. Aus Respekt soll man während des Vortrags nicht essen, sondern zuhören. Just als aufgetragen wird, startet auch die Musik, na toll.
Fado ist nicht gerade eingängig – man muss sich damit beschäftigen, damit man einen Zugang bekommt. Niemand von den Besuchern hat das bis jetzt getan, sonst wären sie nicht ausgerechnet hier gelandet. Die Musiker wissen, dass es keinen Sinn macht, die Seele zu offenbaren und dass es ein bisschen egal ist, was und wie sie spielen. Im besten Fall ist auf Seiten der Besucher das Essen ordentlich und die Musik gut (unsere Hoffnung), auf Seiten der Musiker das Essen ordentlich, das Programm kurz und das Publikum nicht störend. An diesem Abend sind die Instrumentalisten okay, wenn auch manchmal etwas unsicher, die Sängerin divenhaft gut, ein weiterer Sänger mittelprächtig, das Publikum unauffällig und brav, das Programm kurz, die Pausen lang und das Essen lachhaft. Es hätte schlimmer kommen können.
Die ursprüngliche Variante, bei der mehrere Sänger abwechselnd spontan eigene Texte zu bekannten Melodien singen und ein Publikum die Sache zu würdigen weiß, ist mit Sicherheit magisch, aber über diesen Ort sind wir hier leider nicht gestolpert. Allerdings vor ein paar Jahren im Hafen von Athen, dort heißt das Rembetiko. Wir warteten in Piräus auf die Fähre und aßen auf der Terrasse einer Kneipe Sardinen, während man drinnen in kleinem Kreis unbeeindruckt von der Außenwelt ein musikalisches Fest feierte.
In ein musikalisches Fest gelangen wir dann auf dem Heimweg. Schon am Nachmittag haben wir das Haus in der Nachbarschaft inspiziert – ein mehrstöckiger Altbau, in dem die vortags auf dem Plakat entdeckte Veranstaltung stattfindet, irgendwas mit Kunst und Migration, wunderbar, wir sind dabei. Wir finden die Räume in einer Art trägem Zwischenstadium vor – dahindämmernd bis zum abendlichen zweiten Aufschwung (den Hauptabend hatten wir versäumt, doch es soll weitere Darbietungen geben.)
Unten ist ein großer Saal – könnte auch eine Sporthalle sein – mit großer Bühne, es gibt Stände mit afrikanischem Essen sowie eine Kinder-Sambagruppe, die kreuz und quer durch die Gegend spurtet. Im ersten Stock findet sich ein alter Prunksaal und eine Tanzschule, zwei Etagen höher gelangt man zu einer Art Bar, die sich als Außenbereich eines ehemaligen Schwimmbads unterm Dach entpuppt. Das Schwimmbad wiederum wird nun als Bogenschießstand genutzt. Von dort kann man weiter zu einer nächsten Bar unterm Dach, wo es wieder eine Tanzschule gibt und eine Terrasse, von der man dann labyrinthartig wieder runter zur Straße kommt.
Ob es hier noch mehr solcher Parallelwelten gibt, haben wir für's erste nicht rausbekommen, aber es lässt hoffen. Als wir jedenfalls nachts auf dem Heimweg vom Fado wieder dran vorbeikommen, scheint durch den Hinterausgang Licht und wir schauen noch mal kurz rein. Gerade wird für die letzte Band umgebaut. Als sie anfängt und der Saal zu den afrikanischen Rhythmen tanzt, kennen wir schon fast alle um uns herum, haben Drinks in Plastikbechern in der Hand und freuen uns, dass nun wirklich mit allen Sinnen Musik gemacht wird.